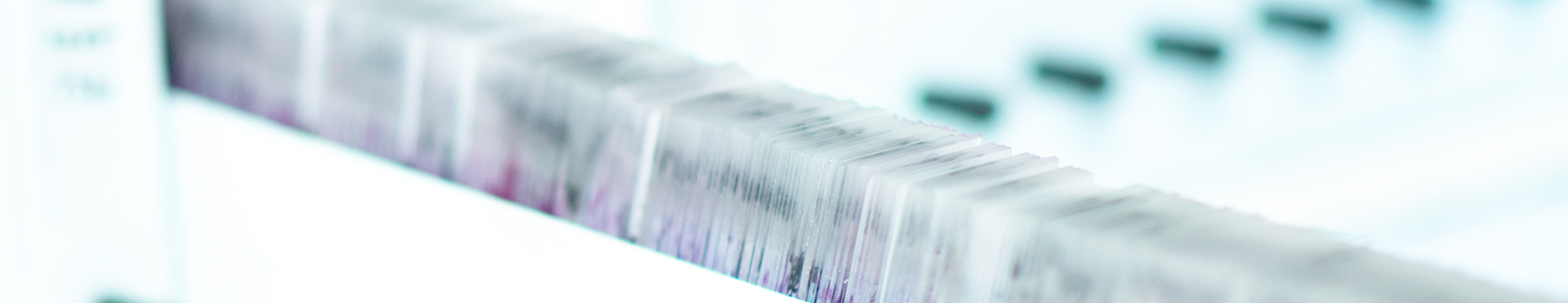AG Thiem
Arbeitsgruppenprofil


In unserer Forschungsgruppe werden grundlagenorientierte und translationale Fragestellungen aus dem Bereich der Dermato-Onkologie und chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen bearbeitet.
Aktuell laufende Forschungsprojekte
Ecological Momentary Assessment (EMA) bei Neurodermitis und Schuppenflechte
Ecological Momentary Assessment (EMA) bei Neurodermitis und Schuppenflechte
Projektbeschreibung
Chronische Hauterkrankungen, insbesondere die Neurodermitis (=atopische Dermatitis) und die Schuppenflechte (=Psoriasis), können für die Betroffenen mit belastendem Juckreiz, Stress und negativen Gefühlen verbunden sein. Ein Absinken der empfundenen Lebensqualität ist die Folge. Ziel unserer Studie ist es, die Wechselwirkungen dieser Belastungsfaktoren im Alltag der Betroffenen genauer zu erforschen.
Dazu wird die Methode des „Ecological Momentary Assessment“ (EMA) verwendet, welche sich Studien als zeit- und kostengünstiges Mittel erwiesen hat, bestimmte Variablen im Alltag der Probanden über deren Smartphone (Handy) zu erheben. EMA kann vielfältig eingesetzt werden, z.B. als digitales Tagebuch zur Erfassungen momentaner Zustände oder als „Onlineworkshop“ zur Bereitstellungen von Übungen/Videos und Materialien.
Unser interdisziplinäres Projekt mit der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Unimedizin Rostock richtet sich an Patientinnen und Patienten mit der Diagnose atopische Dermatitis oder Psoriasis. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Dauer des Projekts beträgt 17 Tage und wird mit einer Aufwandsentschädigung von 100 € vergütet.
Die Untersuchung besteht aus drei Teilen:
- Ausführliche Eingangsuntersuchung durch Dermatologen und Psychologen
- In der Hautklinik
- Dauer ca. 30 Minuten
- Umfasst: dermatologische Bestimmung des Hautzustandes + Ausfüllen verschiedener Fragebögen zum Umgang mit Stress, Gefühlen und dem Hautzustand
- App-basierte Handybefragung (EMA) bzw. digitales Tagebuch
- Im Alltag der Probanden
- 15 Tage, 5x täglich
- Umfasst: Erhebung von momentanem Juckreiz, Stress, Gefühlen, Pflege und Zustand der Haut
- Digitale Abschlussbefragung
- Von zu Hause aus
- Dauer ca. 15 Minuten (online via Link)
- Umfasst: Ausfüllen verschiedener Fragebögen zum Umgang mit Stress, Gefühlen und dem Hautzustand zum Vergleich mit Ausgangswert
Ziel ist es, die Wechselwirkungen von Stress, Juckreiz und aufkommenden Gefühlen besser zu verstehen und daraus patientenorientierte, passende Behandlungsangebote zu kreieren.
Projektleitung und -Mitarbeiter
- PD Dr. med. habil. Alexander Thiem (Projektleitung)
- Nele Nele Reimer, M.Sc. (Versuchsleitung)
- Theresa Kampel (Doktorandin)
Laufzeit
2024 - 2026
Abgeschlossene Projekte
Negative Gefühle bei Neurodermitis und Schuppenflechte
Negative Gefühle bei Neurodermitis und Schuppenflechte
Projektbeschreibung
Die dermatologische Forschung hat das psychische Erleben von Menschen mit chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen in den vergangenen Jahren zunehmend in den Blick genommen. Chronische Hauterkrankungen gehen häufig mit einem hohen psychischen Leidensdruck, Stigmatisierungserfahrungen und Schamgefühlen einher. Stress und seelische Belastungen beeinflussen den Zustand der Haut und können einen dermatologischen Krankheitsschub auslösen.
Die Kliniken und Polikliniken für Dermatologie und Venerologie und für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Rostock erforschen in einem gemeinsamen Projekt die Bedeutung von Scham sowie dessen Zusammenhang mit störungsrelevanten Aspekten, wie Juckreiz und Krankheitsschwere, bei Patient/-innen mit einer ärztlich diagnostizierten Psoriasis (Schuppenflechte) oder atopischen Dermatitis (Neurodermitis).
Hierfür werden Betroffene in einer ca. 20-minütigen Online-Umfrage gebeten, anonym unterschiedliche Fragebögen zu beantworten. Ferner wird in einer Präsenzbefragung durch eine Psychologin erfasst, wie häufig soziale und/oder körperdysmorphe Ängste auftreten.
Ziel unseres Forschungsvorhabens ist die Relevanz von Scham und Schamerkrankungen bei Psoriasis und atopischer Dermatitis zu belegen und dadurch mittelfristig bessere Hilfsangebote für Betroffene zu entwickeln.
Projektleitung und -Mitarbeiter
- PD Dr. med. habil. Alexander Thiem (Projektleitung Dermatologie)
- Clara Wülfing (Versuchsleitung)
Laufzeit
2023 – 2024
NER & Immunregulation
Die Rolle der Nukleotid-Exzisions-Reparatur bei der Immunregulation und dem Ansprechen auf anti-PD-1-Immuntherapien
Projektbeschreibung
Die Möglichkeit, mit monoklonalen Antikörpern spezifische, die Aktivität von T-Lymphozyten hemmende Immunrezeptoren (sog. Immuncheckpoints) zu blockieren, hat in den letzten Jahren die Therapie des fortgeschrittenen Melanoms und anderer Tumorerkrankungen revolutioniert. Seit 2018 ist die Immuncheckpoint-Blockade auch bei der adjuvanten, d.h. unterstützenden, Therapie nach einer Melanomoperation möglich, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Metastasen zu reduzieren. Allerdings ist bisher nicht genau geklärt, welche Patienten auf eine Immuncheckpoint-Blockade ansprechen und welche nicht. Bei bestimmten Patientengruppen wurde berichtet, dass sie besonders von einer solchen Therapie profitieren. Dazu gehören an Xeroderma pigmentosum - Erkrankte. Bei diesen Menschen besteht ein angeborener Defekt in der Nukleotid-Exzisionsreparatur (NER), einem Reparatursystem, das hauptverantwortlich für die Reparatur von durch UV-Licht ausgelösten DNA-Schäden ist. Eine funktionell leicht verminderte NER stellt auch einen unabhängigen Risikofaktor für die Entwicklung verschiedener Krebserkrankungen einschließlich Hautkrebs in der allgemeinen Bevölkerung dar.
Wir untersuchen in unserem Projekt die Auswirkungen von Defekten in der NER auf die Regulation des Immunsystems. Dabei werden wir vor dem Hintergrund defizitärer NER unter anderem die Expression unterschiedlicher Immunmoleküle wie PD-L1, MHC-I und MHC-II analysieren. Zusätzlich planen wir die NER-defizitären Zellen mit UV-Licht zu bestrahlen, die Expression des Tumorsuppressorproteins p53 zu verringern und die Auswirkungen in einer Melanom-T-Zell-Ko-Kultur zu überprüfen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, das Ansprechen auf anti-PD-1 gerichtete Immuntherapien besser zu verstehen.
Publikationen
Fischer S, Hamed M, Emmert S, Wolkenhauer O, Fuellen G, Thiem A. The Prognostic and Predictive Role of Xeroderma Pigmentosum Gene Expression in Melanoma. Front Oncol. 2022; 12:810058. doi: 10.3389/fonc.2022.810058.
Banicka V:, Martens C., Panzer R., Schrama D., Emmert S., Boeckmann L., Thiem A.; Homozygous CRISPR/Cas9 knockout generated a novel functionally active exon 1 skipping XPA variant in Melanoma cells. Intern.J. Mol. Sci., 2022; 23, 11649 (1 – 12). doi: 10.3390/ijms231911649
Projektleitung und -Mitarbeiter
- PD Dr. med. habil. Alexander Thiem (Projektleitung)
- Veronika Banicka (Doktorandin)
- Katharina Mischer (Doktorandin)
Laufzeit
2020 – 2022
Förderung
Hiege Stiftung gegen Hautkrebs (49.700 €)
Nachwuchsförderprogramm der Universitätsmedizin Rostock FORUN 2020 (11.032 €)
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von kaltem Atmosphärendruckplasma bei Rosazea (PROSA)
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von kaltem Atmosphärendruckplasma bei Rosazea (PROSA)
Projektbeschreibung
Rosazea ist eine häufige, chronische Hauterkrankung, die sich fast ausschließlich im Gesicht (Stirn, Wangen, Nase und Kinn) manifestiert und durch Erytheme, Teleangiektasien, entzündliche Läsionen und phymatöse Hautveränderungen gekennzeichnet ist. Zudem führt sie häufig zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität. Die Behandlung bleibt limitiert, da bislang kein einzelnes Therapeutikum alle Symptome gleichermaßen bessert und therapieresistente Verläufen auftreten können.
Kaltes Atmosphärendruckplasma (KAP) ist eine neue, innovative Therapiemodalität und besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen wie z. B. reaktiven Sauerstoff- und Stickstoffspezies, Elektronen und Ultraviolett-Photonen. Neben seiner bereits etablierten Anwendung in der Behandlung chronischer Wunden wird es aufgrund seines antimikrobiellen und immunmodulatorischen Potenzials zunehmend auch für die Therapie anderer dermatologischer Erkrankungen erforscht.
In einem Halbseiten-Pilotprojekt untersuchten wir die Wirksamkeit und Verträglichkeit der KAP-Anwendung mittels des Plasma-Geräts PlasmaDerm® Flex (CINOGY Technologies GmbH, Duderstadt, Deutschland). Die KAP-Behandlung erfolgte einmal täglich für sechs Wochen auf läsionaler Haut einer randomisierten Gesichtshälfte (90 Sekunden pro Areal). Die Endpunkte umfassten Investigator Global Assessment (IGA), Dermatology quality of life Index (DLQI), Anzahl entzündlicher Läsionen, Rötungsintensität und Erythemgröße. Die KAP-Behandlung reduzierte wirksam die entzündlichen Läsionen und die Erythemgröße. Zudem beobachteten wir eine Verbesserung der hautbezogenen Lebensqualität. Die KAP-Therapie erwies sich als gut verträglich.
Publikationen
Hofmeyer S., Weber F., Gerds S., Emmert S., Thiem A., A Prospective Randomized Controlled Pilot Study to Assess the Response and Tolerability of Cold Atmospheric Plasma for Rosacea. Skin Pharmacol Physiol. 2023; 36(4):205-213. doi:10.1159/000533190.
Projektleitung und -Mitarbeiter
- PD Dr. med. habil. Alexander Thiem (Projektleitung)
- Stella Hofmeyer (Doktorandin)
Laufzeit
2021 – 2023